Bewegungswissenschaft
Interviewreihe - Eine Fakultät stellt sich vor #7„Klimawandel, Digitalisierung und Corona – Trendthemen unserer Zeit, die eine interdisziplinäre Herangehensweise notwendig machen.“Interview mit Dr. Mirjam Braßler, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Psychologie
31. Dezember 2020, von Webmaster PB
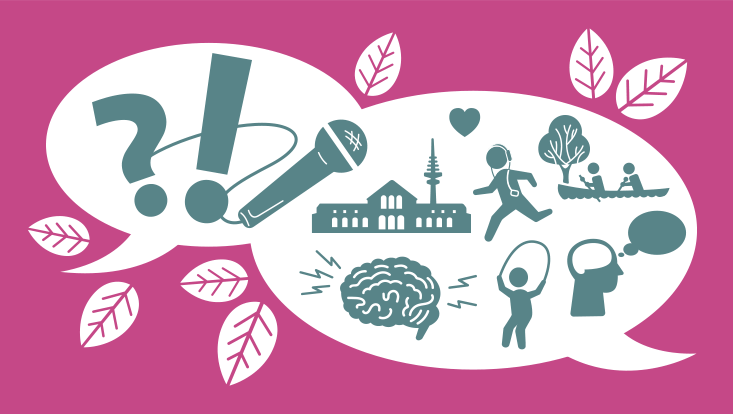
Foto: Wohlfahrt/UHH
Frau Braßler, Sie forschen zu Interdisziplinarität und Nachhaltigkeit in der Lehre sowie der Erstellung von Open Educational Resources (OER) in der Hochschullehre. Ihr Forschungsvorhaben konnten Sie vor Kurzem mit dem Open Science Award krönen. Bitte erzählen Sie uns mehr über ihr Projekt.
Sehr gerne – In dem Projekt geht es darum herauszufinden, wie interdisziplinäres Lehren und Lernen im Themenfeld der nachhaltigen Entwicklung in der Hochschullehre erfolgreich gestaltet werden kann. Klimawandel, Digitalisierung und Corona – Trendthemen unserer Zeit, die nur über das Zusammenwirken verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen verstanden und vermittelt werden können. Die Komplexität dieser gesellschaftlichen Herausforderungen macht eine interdisziplinäre Betrachtung und Herangehensweise notwendig. Um Studierende auf diese fachübergreifende Arbeit optimal vorzubereiten, ist es wichtig, dass sie schon in der Hochschule lernen mit Vertreter*innen anderer Fächer zusammenzuarbeiten. In dem Projekt entwickle ich deshalb unterschiedliche interdisziplinäre Lehr-Lern-Formate, führe diese durch und untersuche die interdisziplinäre Kompetenzentwicklung Studierender mit Vorher-Nachher-Erhebungen und Interviews. Eine Sammlung meiner entwickelten interdisziplinären Lehr-Lern-Methoden habe ich in einem offenen und frei zugänglichem Praxishandbuch Interdisziplinäres Lehren und Lernen. 50 Methoden für die Hochschullehre veröffentlicht.
Können Sie uns einige Beispiele Ihrer entwickelten Lehrmethoden nennen?
Klar! Typische Hindernisse interdisziplinärer Zusammenarbeit sind disziplinbasierte Stereotype, also Zuschreibungen bestimmter Eigenschaften, Einstellungen oder Verhaltensweisen einer Person auf Basis seiner oder ihrer Disziplinzugehörigkeit. Das kennt jeder sicher aus dem Privatleben von Partys. Da fallen schon mal so Sätze wie „Alle Psychologen haben doch einen an der Waffel“ oder „Alle Ökonomen sind Kapitalistenschweine“ oder „Alle Juristen sind rechthaberisch“. Um diese Stereotype aufzubrechen, müssen sie an- und besprochen werden. Das gelingt z.B. mit der Lehr-Lern-Methode „Perspektivwechsel“. Die Studierenden finden sich dazu in interdisziplinären Zweiergruppen ein, z.B. eine Psychologin und ein Informatiker. Dann reflektieren erstmal jeder individuell vier Fragen. Beispiel für die Psychologin (beim Informatiker genau umgekehrt): 1. Wie sehe ich mich als Psychologin oder Psychologe? 2. Wie sehe ich die Informatikerinnen und Informatiker? 3. Wie, denke ich, sehen die Informatikerinnen und Informatiker die Psychologinnen und Psychologen? und 4. Wie, denke ich, sehen die Informatikerinnen und Informatiker sich selbst? Im Anschluss tauschen sich beide aus und gleichen die Bilder ab. Diese Methode sorgt immer für viel Gelächter. Im Anschluss können die Studierenden aber gut zusammenarbeiten, da die Stereotype bereits mal im Raum waren und ihnen dann nicht permanent auf die Füße fallen.
Eine weitere Methode ist das „Interdisziplinäre Bonbon-Verteilen“. Es ist in der interdisziplinären Arbeit sehr wichtig, die jeweils andere Disziplin zu wertschätzen. Für diese Wertschätzung sorgt die Methode. Im Anschluss an die gemeinsame Arbeit, kommen die Studierenden zusammen und reflektieren die Session. Jede und jeder überlegt, was er oder sie von jemandem der anderen Disziplin gelernt hat, was er oder sie an der anderen Disziplin interessant fand, oder auch wer einen fachfremden Inhalt besonders gut erklärt hat. In der Mitte des Raumes steht eine große Schale mit Bonbons. Jede und jeder der Studierenden nimmt sich so viele Bonbon wie er oder sie möchte. Alle gehen zeitgleich durch den Raum und vergeben ihre „Komplimente“ oder ihr „Dankeschön“ in Form eines Bonbons an eine Vertreterin oder einen Vertreter der anderen Disziplin. Diese Methode sorgt für ein Leuchten in den Augen der Studierenden. Wir identifizieren uns so sehr mit unserer eigenen Disziplin, dass disziplinbasierte Wertschätzung und Komplimente einfach guttun.
Sie verknüpften auch das Thema Nachhaltigkeit mit Interdisziplinarität in der Lehre – wie gehen Sie hier vor?
Die großen Themen der Nachhaltigkeit sind so komplex, dass sie sich perfekt für einen interdisziplinären Zugang eigenen. Gleichzeitig sind aber wissenschaftliche Disziplinen so verschieden in ihrer Denkart, in den Methoden, Arbeitsweisen, Werten, Theoriegebilden und Fachsprachen, dass es schnell zu Konflikten kommt. Allein die Frage, was Nachhaltigkeit ist, beantworten die unterschiedlichen Disziplinen schon anders. Deshalb ist es wichtig in der gemeinsamen Arbeit kleinschrittig vorzugehen. Ich nutze da gerne einen problembasierten Ansatz in 8 Stufen: 1.) Begriffe und Konzepte zwischen den Disziplinen klären, 2.) interdisziplinäres Problem definieren, 3.) multidisziplinäres Brainstorming unterschiedlicher Perspektiven der Disziplinen, 4.) Ideen interdisziplinär strukturieren, 5.) interdisziplinäre Lernziele formulieren, 6.) Fachliteratur aus allen beteiligten Disziplinen lesen, 7.) gelesene Inhalte multidisziplinär diskutieren und 8.) interdisziplinäres Teamstatement mit Lösungsansätzen und praktischen Implikationen aufschreiben. Diese Stufen helfen den Studierenden eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, Schritt für Schritt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Disziplinen zu entdecken und final eine integrierte Lösung zu generieren.
Die Studierenden suchen sich ihre Probleme aus dem Themenfeld der Nachhaltigkeit selbstständig aus. Fragen wie: „Wie können wir die Mülltrennung in Hamburg nachhaltig gestalten?“, „Wie ernähren wir uns nachhaltig?“, „Wie können wir Geflüchtete nachhaltig in Hamburg integrieren?“ Diese Fragen ist höchstspannend. Besonders ganzheitliche Lösungsideen entstehen, wenn sich Studierende über die Grenzen der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften begegnen. Das ist immer wieder eine Entdeckung einer anderen Welt – auch für mich. Das macht einfach Spaß!
Zur Person
Ganz im Sinne ihres Forschungsthemas, hat Mirjam Braßler einen interdisziplinären Studienhintergrund. Sie schloss zuerst ein Bachelorstudium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg ab, um im Anschluss an der Ruprecht-Karls Universität Heidelberg den Bachelor Psychologie und an der Maastricht University den Master Psychologie zu studieren. Ihr Studium der Erziehungswissenschaften sowie ihre Promotion zum Thema „Interdisziplinäres Lernen“ schloss sie dann wieder an der Universität Hamburg ab. Seit 2014 forscht sie zum Phänomen der Interdisziplinarität im Arbeitsbereich der Arbeits- und Organisationspsychologie in der Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaft an der Uni Hamburg.


